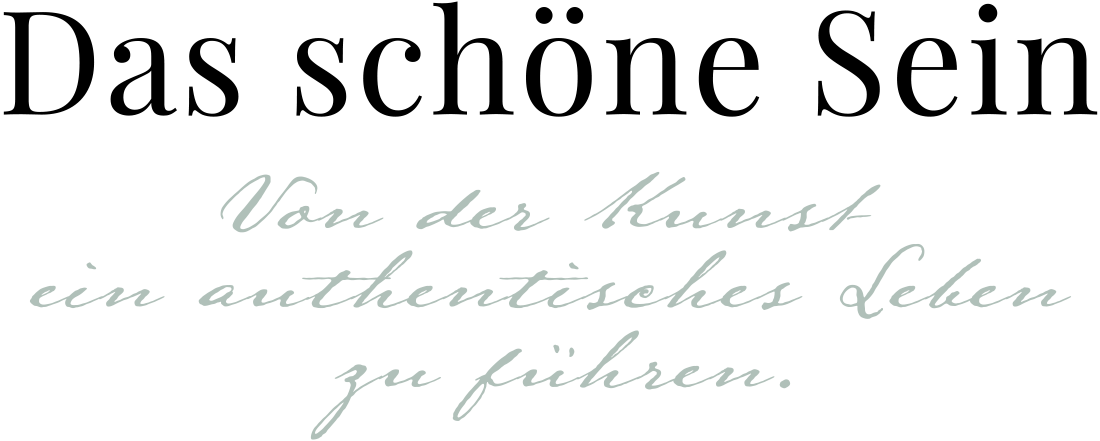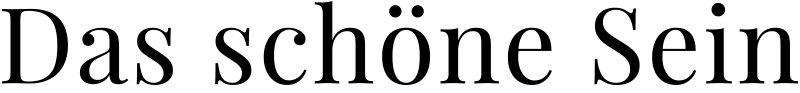Auch wenn wir vermeintlich alle unfassbar individuell und einzigartig sein dürfen, hashtags nutzen wie #diversity und #happytobeme sowie Selflove auch in großer Runde als Mittel gegen alle körperlichen und seelischen Wehwehchen weiterempfehlen: Ich-Sein ist nach wie vor nicht wirklich en vogue.
Es mag hip sein, eigenartig zu erscheinen, aber nur solange es gewissen Regeln und Konformitäten folgt. Die Natur des Menschen ist ein Denken in Schubladen, ein Filtern mit gröberen und feineren Rastern und ein Festhalten an Mustern und Wiederholungen. Nicht nur, dass wir die anderen einsortieren können wollen, wir wollen auch selbst gerne irgendwo dazugehören.
Besser gegen etwas sein, als gar keine Meinung haben. Besser sich verstanden fühlen, als ganz allein den Verstand verwenden…

Zu meinen Agenturzeiten gehörte es zum guten Ton möglichst alternativ zu sein. Seltsamerweise übersahen dabei alle ganz offensichtlich, dass sie durch ihre gemeinsame Andersartigkeit genauso eine Szene waren, wie die, von denen sie sich eigentlich abheben wollten.
Wer schon mal bei einer Vernissage war, wird wissen, was ich meine. Kaum jemand will individueller erscheinen als Künstler. Doch als Aussenstehender sehen sie tatsächlich alle auf peinlich berührende Art und Weise gleich aus.
Wir passen uns an und gleichen uns an. Denn wer möchte schon gerne allein sein?
Und alleine fühlt man sich zwangsweise, wenn man ganz man selbst ist. Weil man dann nämlich tatsächlich nirgends wirklich dazugehört, weil es niemanden gibt, der einem in allen Facetten gleicht. Das ist einerseits wundervoll, denn Unikate sind wahrhaft wertvoll. Aber es ist auf der anderen Seite auch schmerzhaft, weil man nur für sich steht. Vor allem, weil man im Normalfall nicht alles gut finden kann, was einen selbst ausmacht. Gibt es noch andere, die auch so sind, kann man in ihnen eine Art Legitimation der eigenen Fehler entdecken. Erleichternd. Zumindest fürs Erste.